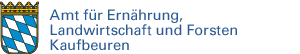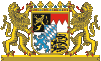Fachinformationen, Fördermöglichkeiten und Erfahrungen aus der Praxis
Nachhaltige Moorbodenbewirtschaftung – Chancen und Herausforderungen
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© Prof. Dr. Drösler
Im Ostallgäu liegen über 12.500 ha Moorböden, mehr als die Hälfte davon werden als Dauergrünland genutzt. Beim Moortag des AELF Kaufbeuren im Herbst 2025 ging es um die Zukunft der Bewirtschaftung von Moorstandorten und die Grenzen der entwässerungsbasierten Nutzung.
Wer Moor hört, denkt an seltene Pflanzen, Nebel und Naturschutz. Doch beim Moortag des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kaufbeuren stand etwas anderes im Mittelpunkt: die schwindende Grundlage der Landwirtschaft selbst. Denn auf vielen Flächen, die einst aus Moor gewonnen wurden, wird der Boden buchstäblich dünn.
Der Torf, der schwindet
„Wir stehen vor der Endlichkeit der Bewirtschaftung entwässerter Moorflächen“, sagte Prof. Dr. Drösler vom Peatland Science Centre der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf gleich zu Beginn. Sein Beispiel war eindrücklich: Ein Messpfahl im Donaumoos zeigt, dass der Boden seit 1836 um über drei Meter abgesackt ist. Trockengelegte Moorflächen verlieren jährlich zwischen 0,5 und 2 cm Bodensubstanz, dadurch, dass sich der organische Torf an der Luft zersetzt – mit schwerwiegenden Folgen für Bodenstruktur, Wasserhaushalt und Klima. Die Böden reißen auf, verwehen und haben bei Starkregen nicht mehr die ursprüngliche Wasseraufnahme- und Haltefähigkeit (Abbildung 1). In spätestens 30 Jahren, so Herr Drösler, sei bei ca. 40% der Moorflächen die Grenze der entwässerungsbasierten Bewirtschaftbarkeit erreicht.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© Florian Mörtl | AELF Kaufbeuren
Trotzdem wird weiter gemäht und gedüngt – aber anders. Landwirt Jürgen Hummel in Lamerdingen sammelt bereits seit 2023 Erfahrungen mit der Bewirtschaftung von wiedervernässtem Grünland im Rahmen des Verbundprojektes „MoorWERT“. Auf seinem Betrieb stellte Herr Walz von den Bayerischen Staatsgütern, Versuchsstation Karolinenfeld, Maschinen und Geräte vor, die für nasses Grünland taugen: leichte Fahrzeuge mit Raupenlaufwerk, angepasst an weiche, feuchte Böden. Seinen Ladewagen hat der Landwirt selbst umgebaut, um den sensiblen Moorboden nicht zu verdichten (Abbildung 2). Der Zeitpunkt für die Mahd wird so gewählt, dass die Flächen tragfähig sind, wodurch mitunter mit einiger Verschiebung bei der Ernte gerechnet werden muss, berichtete Jürgen Hummel.
Die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) hat vor Ort Messtürme installiert, um zu beobachten, wie sich CO₂-Aufnahme und Abgabe des Bodens nach einer Wiedervernässung verändern. Auf der betroffenen Betriebsfläche konnte bereits CO₂-Neutralität nachgewiesen werden. Aber wie nutzt man solche Moorflächen sinnvoll?
„Rohrschwingel ist eine Schlüsselpflanze“, erklärte Herr Drösler. Das robuste Gras eigne sich als Futter für Pferde oder Trockensteher, da es u.a. der Milchfieberprophylaxe diene. Der Rohrschwingel kann ohne Grünlandumbruch durch Schlitzsaat angesät werden und entwickelt schnell tragfähige Bestände. Bei Anbau von Paludikulturen zur stofflichen Nutzung erfolgt die Ernte in der arbeitsarmen Zeit im Winter, wenn die Böden tragfähig sind. Masseerträge von 10-12 t TM/ ha und Jahr seien hier möglich. Die Beweidung wiedervernässter Flächen durch geeignete Rinderrassen habe sich ebenfalls bewährt.
Die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) hat vor Ort Messtürme installiert, um zu beobachten, wie sich CO₂-Aufnahme und Abgabe des Bodens nach einer Wiedervernässung verändern. Auf der betroffenen Betriebsfläche konnte bereits CO₂-Neutralität nachgewiesen werden. Aber wie nutzt man solche Moorflächen sinnvoll?
„Rohrschwingel ist eine Schlüsselpflanze“, erklärte Herr Drösler. Das robuste Gras eigne sich als Futter für Pferde oder Trockensteher, da es u.a. der Milchfieberprophylaxe diene. Der Rohrschwingel kann ohne Grünlandumbruch durch Schlitzsaat angesät werden und entwickelt schnell tragfähige Bestände. Bei Anbau von Paludikulturen zur stofflichen Nutzung erfolgt die Ernte in der arbeitsarmen Zeit im Winter, wenn die Böden tragfähig sind. Masseerträge von 10-12 t TM/ ha und Jahr seien hier möglich. Die Beweidung wiedervernässter Flächen durch geeignete Rinderrassen habe sich ebenfalls bewährt.
Förderprogramme und Flächentausch
Florian Mörtl vom AELF Kaufbeuren stellte Fördermaßnahmen für moorbodenschonende Bewirtschaftung vor. Die Fördermodule M12, M14 und M16 zielen darauf ab, den Erhalt wertvoller Moorböden mit den wirtschaftlichen Interessen der Landwirtschaft zu vereinen sowie bereits erbrachte Leistungen bei der Bewirtschaftung von Moorböden zu entlohnen. Während bei der Maßnahme M12 das Vorhandensein von Nässe-Zeigerpflanzen auf bewirtschafteten Moorflächen mit 600 €/ha entlohnt wird, braucht es für die Maßnahmen M14 und M16 echten Pioniergeist. Denn hier wird die Wiedervernässung von Flächen gefördert. „Das Vorhaben muss in ein betriebsindividuelles Konzept passen“, sagte Mörtl. wiedervernässungswillige Landwirte werden umfassend unterstützt und begleitet.
Ein wichtiger Partner bei der Umstellung ist das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben: Markus Deißler erklärte, dass Stauanlagen über das Programm „FlurNatur“ bis zu hundert Prozent gefördert werden. Vermessungen und Gutachten übernimmt das Amt, ebenso hilft es beim freiwilligen Landtausch – ein oft entscheidender Schritt, um zusammenhängende hydrologische Einheiten zu schaffen. Anhand eines konkreten Beispiels zeigte Herr Deißler, wie in der Gemeinde Bidingen eine große Tauschfläche gegen zahlreiche kleine Moorbodenparzellen eingetauscht wurde. Tauschpartner mit Interesse an Moorflächen können Behörden, Kommunen oder Unternehmen sein, die Ausgleichsflächen oder Flächen für Naturschutzzwecke benötigen. „Auch ein Flächentausch von Mineralböden mit Moorböden zwischen intensiv und extensiv wirtschaftenden Landwirten mit Interesse an Wiedervernässungsmaßnahmen wird angestrebt“, betonte Herr Deißler.
Ein wichtiger Partner bei der Umstellung ist das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben: Markus Deißler erklärte, dass Stauanlagen über das Programm „FlurNatur“ bis zu hundert Prozent gefördert werden. Vermessungen und Gutachten übernimmt das Amt, ebenso hilft es beim freiwilligen Landtausch – ein oft entscheidender Schritt, um zusammenhängende hydrologische Einheiten zu schaffen. Anhand eines konkreten Beispiels zeigte Herr Deißler, wie in der Gemeinde Bidingen eine große Tauschfläche gegen zahlreiche kleine Moorbodenparzellen eingetauscht wurde. Tauschpartner mit Interesse an Moorflächen können Behörden, Kommunen oder Unternehmen sein, die Ausgleichsflächen oder Flächen für Naturschutzzwecke benötigen. „Auch ein Flächentausch von Mineralböden mit Moorböden zwischen intensiv und extensiv wirtschaftenden Landwirten mit Interesse an Wiedervernässungsmaßnahmen wird angestrebt“, betonte Herr Deißler.
Zwischen Milch und Moor
Dass auch die Molkereien hinschauen, machte Emily Schrödel, Nachhaltigkeitsmanagerin der Molkerei Karwendel deutlich. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben musste sich das Unternehmen verbindliche Klimaziele setzen. Die Molkereien sind dabei verpflichtet, auch den vor- und nachgelagerten Bereich miteinzubeziehen. „90 Prozent der Treibhausgasemissionen entstehen in den Betrieben“, erklärte Frau Schrödel. Man wolle die Landwirte nicht drängen, sondern einbinden, denn die Rohstoffsicherheit muss gewährleistet sein. Über sogenannte Klimachecks und Bonusprogramme könnten künftig auch Betriebe profitieren, die ihre Moorflächen nachhaltig bewirtschaften.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
© Florian Mörtl | AELF Kaufbeuren
Projektleiter Andreas Stauss vom Bundesprojekt „MoorWERT“ im Ostallgäu zeigte, dass auch wirtschaftliche Nutzung jenseits der Futterproduktion möglich ist: Pflanzenkohle aus Mooraufwuchs und Paludi-Bauplatten aus Schilf oder Rohrkolben sind Beispiele für innovative Produkte aus dem Moor. Sowohl regionale Startups als auch namhafte Unternehmen wie z.B. Obi und Baufritz zeigen Interesse und Initiative beim Einsatz und der Weiterentwicklung solcher Moorerzeugnisse.
Der Moortag des AELF brachte vor allem eine Erkenntnis: Wenn der Boden Grenzen setzt, liegt darin keine Sackgasse, sondern ein Anstoß zum Weiterdenken. Jeder Landwirt weiß, dass Innovation oft dort beginnt, wo man mit dem Bestehenden sorgsam auskommen muss. Die Zukunft liegt nicht im Verzicht, sondern im Finden wirtschaftlicher Lösungen, sodass landwirtschaftliche Flächen auch zukünftig ertragreich bleiben.
Der Moortag des AELF brachte vor allem eine Erkenntnis: Wenn der Boden Grenzen setzt, liegt darin keine Sackgasse, sondern ein Anstoß zum Weiterdenken. Jeder Landwirt weiß, dass Innovation oft dort beginnt, wo man mit dem Bestehenden sorgsam auskommen muss. Die Zukunft liegt nicht im Verzicht, sondern im Finden wirtschaftlicher Lösungen, sodass landwirtschaftliche Flächen auch zukünftig ertragreich bleiben.